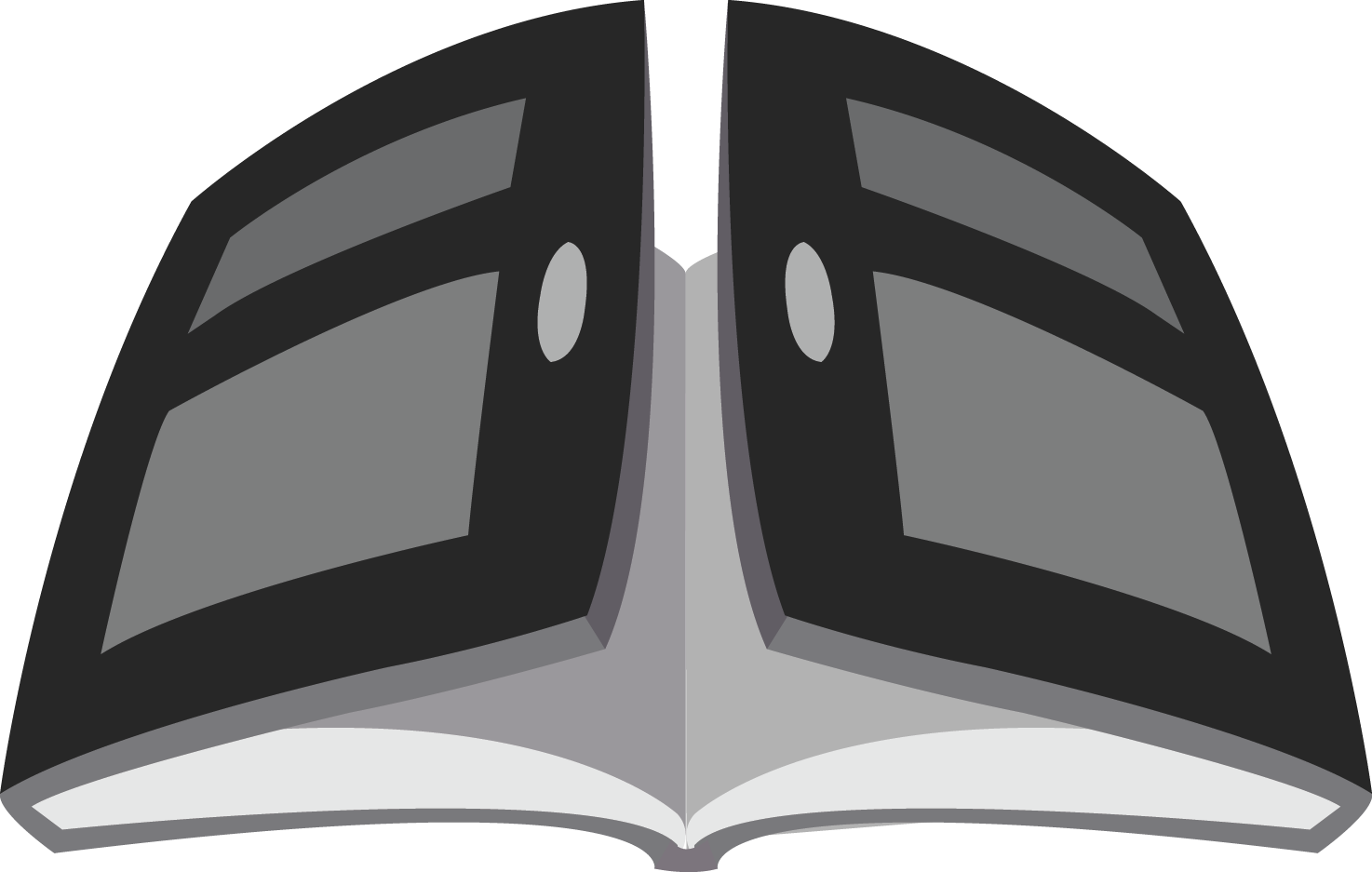Schon so oft hörte ich die Worte: »Na, dann schreib es doch auf, schreib es doch auf …« Und jedes Mal, wenn mir wieder etwas auffiel, von dem ich wusste, dass es mich tagelang beschäftigen würde, dachte ich sie, diese Worte. Sie erscheinen mir vor meinem geistigen Auge, kleben an mir wie mein Schatten. Sie schlafen mit mir ein und wachen mit mir auf. Aber wenn ich nun immer aufschriebe, was mir auffiele …? So hätte ich wohl kaum zu etwas anderem noch Zeit. Ich müsste mich verstecken, weit weg von der Zivilisation und fern in der Wildnis. Dort würde ich auch schreiben, sicher würde ich das. Doch wären es andere Worte, die sich aneinanderreihten. Worte der Farben und Elemente, das Geräusch der Stille – man könnte mal in Ruhe nachdenken. Zumindest stelle ich es mir so vor … nur muss ich jetzt schon wieder an das denken, was ich gerade erlebt habe. Und ich bilde mir ein, dass wenn ich erst mal meine Dosis täglicher Zivilisation niedergeschrieben habe, ich mich dann auf meine Wunschgedanken konzentrieren kann. Hier jetzt also mein Versuch, schlechte Gedanken loszuwerden.
Es ist Samstag im April des Jahres 2016. Gegen 12.30 Uhr verlasse ich meine Wohnung und habe nichts weiter vor, als nach meinem Postfach im Marktplatz Center zu sehen. Da ich mich etwas bewegen möchte, mache ich einen kleinen Umweg und gehe in Richtung des Fritz Reuter Hauses die Pfaffenstraße entlang. Es ist ein warmer Tag im April, und ich genieße die Sonnenstrahlen. Eine Familie steht vor dem Fritz Reuter Haus und bestaunt den Wetterhahn oben auf dem Dach. Er dreht sich mit dem Wind und quietscht ein bisschen. Ich versuche zu erkennen, ob er golden glänzt oder vielleicht sogar bunt bemalt ist. Manchmal lassen sich die Leute ja was einfallen. Wie die Familie schaue ich hoch zum Dach, muss aber plötzlich in Richtung Tattoo Geschäft gegenüber gucken, weil von dort lautes Gerede zu hören ist. Die Familie erschreckt sich wie ich und schaut interessiert dorthin. Wahrscheinlich stellen wir uns die gleiche Frage – Was haben die denn nur? Die zwei Kinder, offenbar Immigranten, reden laut und gestikulieren so wild wie Erwachsene, die sich über irgendetwas echauffieren. Dabei sind sie so sehr in ihr Gespräch vertieft, dass sie nicht mitkriegen, wie seltsam ihr Verhalten auf die Familie wirkt. Vermutlich sind es Touristen, denke ich und gehe weiter.
Vielleicht hat die Familie nicht damit gerechnet, auch in Neubrandenburg auf Immigranten zu treffen. Neubrandenburg ist ja schließlich nicht Rostock oder Schwerin. Aber seit letztem Sommer sehe ich täglich Immigranten und oft gefällt mir nicht, was ich sehe. Zudem weiß ich, dass ich nicht die Einzige bin, die so denkt. Denn auch das sehe ich.
An der Konzertkirche vorbei gehe ich weiter, bis ich in die Dümperstraße Richtung Marktplatz Center einbiege. In diesem Moment treffe ich auf zwei Immigranten, junge Männer, die mit Tüten vom Media Markt und Deichmann gerade von dort gekommen sein mussten. Sie verstummen, als sie verstehen, dass ich mir meine Hälfte Fußgängerweg nicht streitig mache.
Bevor ich einem Mann, dem ich ansehe, dass er mein Geschlecht für weniger Wert hält, Platz mache, muss aber noch ganz viel geschehen! Seit letztem Sommer habe ich so viel frauenfeindliches Verhalten gesehen und auch selbst erlebt … ich sollte mal ein Buch darüber schreiben.
Ich gehe weiter und höre noch, wie beide Männer über mich reden. Ich weiß nicht, was sie sagen, denn ich spreche kein Arabisch. Aber ich weiß, dass sie über mich reden, denn sie sehen mich dabei an, bevor sie ihren Blick abwenden und in die andere Richtung weitergehen.
Minuten später erreiche ich das Marktplatz Center, Drehtür Eingang Süd. Sofort fällt mir eine ältere Frau auf, die mit ihrem Enkel (oder Sohn, ?) wie ich Richtung Post geht. Sie verschwinden aus meinem Sichtfeld, als ich mein Postfach öffne. Doch plötzlich zucke ich zusammen, als ich sie das Kind anschreien höre und ich schaue zum Geldautomat. In diesem Moment schlägt die Frau dem Jungen ins Gesicht – ein richtiger Klatscher auf die Wange. Ich bin fassungslos und schaue mich um, ob noch jemand anderes so schockiert ist wie ich. Aber ich kann niemanden ausmachen – die Leute sind mit sich selbst beschäftigt oder hatten vielleicht nur kurz registriert, was am Geldautomat vorgefallen ist und sind dann weitergegangen.
Ich schließe mein Postfach ab und gehe auf die Frau zu. Als ich vor ihr stehe, schaut sie mich ganz erschrocken an. Offensichtlich hat sie nicht damit gerechnet, dass jemand sie auf ihr Verhalten anspricht. Ich möchte von der Frau wissen, ob es denn unbedingt nötig war, den Jungen zu schlagen. Sie antwortet, er bräuchte das, anders verstünde er es nicht. Verstünde »was« nicht, frage ich mich und frage die Frau, ob nicht fortwährend gutes Zureden besser wäre. Der Junge heult und steht hinter ihr. Versteckt sich geradezu vor mir. Das finde ich seltsam, und ich frage mich, ob der Junge regelmäßig geschlagen wird und bereits denkt, es läge tatsächlich an ihm, wenn sich schon jemand Fremdes einmischt. Die Frau jedenfalls schüttelt mit dem Kopf und beteuert, schon alles versucht zu haben, aber nichts würde helfen. Ich sehe, wie sich ihre Augen röten und verstehe, dass die Frau verzweifelt ist. Darauf weiß ich dann auch nichts mehr und wende mich von der Frau ab.
Ich spüre meine Nase kitzeln und versuche, mich abzulenken, indem ich mir vorstelle, wie ich in den nächsten Minuten im Zeitschriftengeschäft nach der aktuellen Ausgabe von Der Spiegel suchen werde. Auf dem Weg dorthin treffe ich auf eine afrikanische Muslima, die mit einer Hand einen Kinderwagen vor sich herschiebt und mit der anderen versucht, ihr Kind davon abzuhalten zum Springbrunnen zu laufen. Damit Mutter und Kind genügend Platz haben, um miteinander zu kämpfen, weiche ich aus und nehme einen kleinen Umweg in Kauf – so wie es sich in so einer Situation gehört, zumindest habe ich das mal so gelernt. Noch ganz in Gedanken über die Frau mit dem Kind am Geldautomat laufe ich im Zeitschriftengeschäft auch gleich bis nach ganz hinten durch. Dort frage ich mich, was ich überhaupt noch mal wollte und muss erst mal meine Gedanken sortieren.
Wieder Minuten später bin ich mit meiner Zeitschrift in der Tasche unterwegs zum Edeka, denn ich habe vor, mir auf den Schreck mit dem Wangenklatscher, ein Eis zu gönnen. Als ich vor der Eisvitrine stehe, frage ich mich wieder, was ich überhaupt noch mal wollte. Dann mache ich einen Fehler – ich schaue nach links zu dem Schatten, der mich seit ein paar Sekunden beobachtet. Man merkt ja, ob man angestarrt wird. Dieses Mal ist es einer, dem sogar der Mund offen steht, weil er wahrscheinlich bis dato blonde Frauen nur aus dem Fernsehen her kannte. Ich flüchte rechts um die Eisvitrine und tue so, als ob ich dort das passende Eis für mich finden würde. Tatsächlich frage ich mich, ob die Schlangen an den Kassen lang oder kurz sind. Für den Fall, der Typ würde mir bis zur Kasse folgen, wäre es natürlich besser, wenn ich nicht so lange warten müsste. Aber dieser Gedanke war Zeitverschwendung, denn der Mann steht plötzlich neben mir.
Sicher könnte ich darauf hinweisen, dass ich mich belästigt fühle. Aber dann hätte er ja das bekommen, was er wollte – Kontakt. Fairerweise sollte ich hier klarstellen, dass ich generell nicht auf solch plumpe »Kennenlernversuche« anspringe, selbst nicht von Deutschen, mit oder ohne Migrationshintergrund. Nur haben dieser Art Belästigungen in letzter Zeit extrem zugenommen und sie gehen mir unglaublich auf die Nerven. Mal ehrlich, man sieht doch, wie man vom Kulturpark nach Downtown kommt. Für etwas anderes als »You know how to come to downtown, baby!« bin ich da nicht bereit.
Eilig bahne ich mir einen Weg raus aus dem Edeka – zwei Kassen geöffnet, zur Mittagszeit an einem Samstag. »Entschuldigen Sie bitte. … Dürfte ich vorbei? … Entschuldigung? … Danke. … Entschuldigung. … Vielen Dank.« Ich gehe Richtung Osteingang zum Marktplatz und mir fällt auf, dass an diesem Tag eigentlich gar nicht so viele Immigranten im Marktplatz Center sind. Manchmal kommt man sich ja vor wie ein Affe im Zoo, so beobachtet wie man sich fühlt. Oder wie es der Schriftsteller Abbas Khider im Spiegel erklärt: »… In »Ohrfeige« vertreiben sich die Flüchtlinge die Zeit in einem Einkaufszentrum, sie sind Zuschauer des Lebens der Deutschen: ›Zu gern wollten wir sein wie sie. Einkaufen, im Café sitzen, Getränke bestellen und mit einer der vielen jungen Kellnerinnen plaudern. Aber wie sollte das gehen? Wir standen mittendrin, und doch waren wir meilenweit von alldem entfernt. Die Einheimischen gingen shoppen, wir wärmten uns am ihren Leben.‹«
Draußen auf dem Marktplatz ist der Grüne Markt zugegen. Frühlingsblumen, frisches Gemüse und geräucherter Fisch. Herrlich – alles Produkte aus der Region. Wäre da nicht auf einmal dieser dämliche Spruch: »Buongiorno, signora.« Ich rede mir ein, dass eine andere Frau als ich gemeint ist und stelle mir vor, wie unzählige Italienerinnen mit mir den Marktplatz Richtung Turmstraße verlassen. Kurz vorm Zebrastreifen drehe ich mich um 90 Grad direkt gen New Brand ’n‘ Burger und kaufe mir dort einen Burger, statt wie zuvor geplant Eiscreme. Warum? Weil ich beim Verlassen des Marktplatzes auf einmal in zwei finster blickende Mienen älterer Immigranten schaue, die ich in der Turmstraße nicht hinter mir haben möchte. Ich finde, einigen Immigranten sieht man einfach an, wie wenig sie vom Lebens(Kleidungs-)stil westlicher Frauen halten.
Keine Ahnung, wie lange ich mir das noch gefallen lassen werde. Ich weiß nur, dass bei zu vielen Zugeständnissen Frauen immer weiter separiert werden. Da kann man doch nur Feministin sein!
Unverkäuflicher Text von Doreen Gehrke. Die Verwendung dieses Textes, ob nun auszugsweise oder in vollem Umfang, ist ohne schriftlicher Zustimmung von Doreen Gehrke urheberrechtswidrig. Auch eine Übersetzung des Textes sowie die Verwendung in elektronischen Systemen ist strafbar.